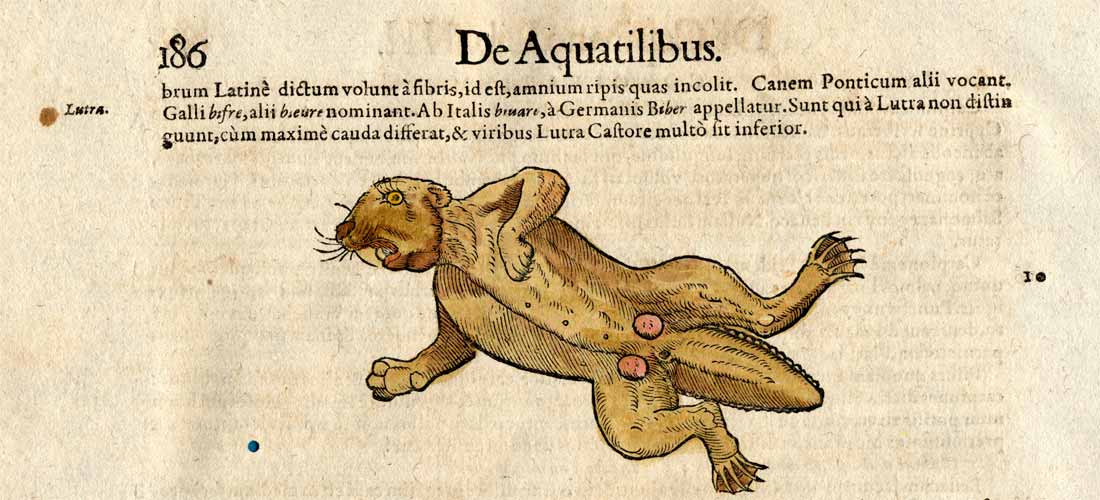Jagd- und Lebensbilder aus Amerika Nr. 1. Biberjäger. in: Die Gartenlaube , Leipzig: Ernst Keil, 1855, Seite 202
Jagd- und Lebensbilder aus Amerika.[1]
Nr. 1. Biberjäger.
Die amerikanischen Biberjäger (Trappers) stehen den Indianern näher als den civilisirten Menschen. Sie bringen den größten Theil ihres Lebens in den verborgensten Winkeln der Berge und den fernsten Wildnissen zu. Ihre Sitten und Charakter sind eine Mischung von Einfachheit und Wildheit, die ihnen von der majestätischen Natur, in deren Mitte sie stets leben, eingeflößt zu sein scheint. Nahrung und Kleider sind dort ihre einzigen Bedürfnisse, und um sich diese unentbehrlichen Dinge zu verschaffen, übernehmen sie die größten Gefahren und Mühseligkeiten. Die Büchse in der Hand sind sie fortwährend auf der Wacht gegen das, was ihnen droht, oder mit der Erwerbung des nöthigen Proviants beschäftigt. Aufmerksame und scharfe Beobachter der Natur, wetteifern sie mit den Thieren der Wälder, und deren Gewohnheiten zu belauschen, und indem sie stets allen möglichen Gefahren ausgesetzt sind, fühlen sie selbst niemals, was Gefahr bedeutet, und mit derselben Gleichgültigkeit, mit der sie ihr eigenes Leben preisgeben, vernichten sie menschliches Leben so leicht wie das der Thiere. Menschliche Gesetze kennen sie nicht; ihr Wunsch ist ihr Gesetz, und um diesen Wunsch zu erfüllen, ist ihnen jedes Mittel recht. Treu als Freunde, unerbittlich als Feinde, gilt bei ihnen der Satz: „ein Wort und ein Schlag“, oft kommt aber der Schlag noch eher als das Wort. Ihre guten Eigenschaften sind denen vergleichbar, die man bei den Thieren findet; freilich, wer jedes Ding gern bei seinem schlechtesten Namen nennt, dem sind sie rachgierige, blutsüchtige Trunkenbolde, Spieler, Menschen, die die Begriffe von Mein und Dein nicht achten, kurz: „weiße Indianer.“ Doch giebt es viele Ausnahmen unter ihnen und es gehört gar nicht zu den Seltenheiten, daß der Reisende in den Felsengebirgen (Rocky mountains) unter den Biberjägern manchen ehrlichen und treuen Burschen trifft, der freudig seinen letzten Bissen mit ihm theilt.
Stark, gewandt, abgehärtet, muthig und waffengeübt wie sie sind, giebt es keinen Winkel, keine Wildniß im „fernen Westen“ von Nordamerika, der von diesen so furchtlosen wie furchtbaren Männern nicht untersucht und durchstreift werden wäre. Von den Quellen des majestätischen Mississippi bis zu den Mündungen des Colorado, von den eisigen Gegenden des Nordens bis zum Gila in Mexiko haben die Biberjäger ihre Fallen in jeden Strom, jeden Fluß, jeden Bach gelegt. Diese ungeheuern Länderstrecken würden ohne das rastlose Vordringen dieser Männer eine terra incognita für die Geographen sein, und obgleich ein großer Theil davon dies auch jetzt noch für sie ist, so giebt es doch, das darf man wohl behaupten, kaum einen Acker Landes, der von den Biberjägern auf ihren gefahrvollen Streifzügen nicht vor- oder rückwärts durchschritten worden wäre. Die Berge und Flüsse führen noch die Namen, welche ihnen diese mannhaften Jäger gegeben haben, und sie sind in Wahrheit die unermüdlichen Pioniere, die der täglich an Wohlstand wachsenden Colonie des Westens den ersten Weg gebahnt haben.
Die Biberjäger zerfallen in zwei Klassen: die gemietheten und die freien; erstere werden von der Pelzwerkcompagnie ausschließlich zum Zwecke der Jagd in Dienst genommen; letztere werden von der Compagnie mit Pferden, Mauleseln und Fallen versehen und erhalten für die Felle und das Pelzwerk einen gewissen Preis. Außer diesen beiden Klassen giebt es aber noch eine dritte Art Jäger, die für ihre eigene Rechnung jagen, ihre eigenen Pferde und Packthiere besitzen und sich ihren Jagdbezirk und Markt selbst wählen.
Sobald sich der Biberjäger auf den Marsch begiebt, erhält er seine ganze Ausrüstung entweder an einem der indianischen Handelsforts oder von den Hausirern und Handelsleuten, welche nach den westlichen Staaten kommen. Die Ausrüstung besteht in zwei oder drei Pferden und Mauleseln, eins für den Sattel, die andern für das Gepäck, und aus sechs Fallen, die in einem ledernen Sack aufbewahrt werden. Munition, ein Paar Pfund Taback, gegerbte Thierfelle zu Moccasins (eine Art indianischer Schuhe), und manche andere kleine Dinge führt er mit sich in einem Sack von Büffelfell. welcher daher sinnreich „Possible-Sack“, der Sack für alles Mögliche, genannt wird. Dieser Possible-Sack zugleich mit dem Sacke, in welchem die Fallen stecken, hat gewöhnlich seinen Platz auf dem Sattelmaulesel, wenn gejagt wird; die übrigen Dinge werden mit dem Pelzwerk eingepackt. Die Kleidung des Biberjägers besteht in einem Jagdhemd von gegerbtem Ziegenfell, das mit langen Franzen verziert ist; die Hosen sind gleichfalls von Ziegenfell, und auf der Außenseite auch mit Franzen versehen. Ein schwarzer oder grauer weicher Filzhut, Moccasins und Teggins (eine Art Gamaschen) vervollständigen den Anzug des Jägers. Ueber die rechte Schulter geht ein Riemen und in diesem hängt unter dem linken Arm ein Pulverhorn und ein Kugelbeutel, in welchem letzteren zugleich noch eine Menge für die Jagd unentbehrliche Dinge ihren Platz finden. Um den Leib trägt der Jäger einen Gürtel mit einem großen Bowiknife (einem langen und breiten Messer) in einer Scheide von Büffelfell, die mittels einer stählernen Kette, die zugleich einen kleinen Ziegenfellbeutel mit einem Wetzstein zum Schleifen der Waffen festhält, befestigt ist. Oft hat der Jäger auch einen Tomahawk (indianische Streitaxt) bei sich. Seine Hauptwaffe ist aber seine geliebte weittragende und nimmer fehlende lange und schwere Büchse, die er gelegentlich auch als furchtbaren Streitkolben zu handhaben weiß. Um die Ausrüstung vollzählig zu machen gedenken wir schließlich noch des „Pipeholders“ (Pfeifenhalters), der in einer um den Hals herumgehenden Schnur hängt, meist in Form eines Herzens (denn unser Jäger hat seine sehr gemüthliche Seite) genäht, mit Perlen besetzt und gewöhnlich ein Geschenk von des Jägers „Squaw“. (Squaw ist bei den Indianern zunächst jede weibliche Person im Allgemeinen; dann aber heißt es so viel wie Frau.)
Ist dann nun unser Jäger mit Allem versehen, was er für nothwendig zu seinem Vorhaben hält, und hat er im Voraus schon den Platz für seine Jagden bestimmt, so beginnt er seinen Auszug in die Berge, entweder allein oder in Gesellschaft Mehrerer. Sobald im Frühjahr das Eis aufbricht, ist seine Zeit gekommen. Angelangt in seinem Jagdbezirk, folgt der Biberjäger den kleinen Flüssen und Bächen und hält scharfen Ausguck auf das „Zeichen“.
1) Unter diesem Titel werden wir eine Reihe Schilderungen aus dem Amerikanischen Jagd- und Waldleben bringen, die viel Interessantes bieten.
Bemerkt er einen umgeworfenen Baumwollenbaum, so untersucht er ihn, ob es vielleicht ein Biber war, der den Baum gefällt hat, um damit den Strom aufzudämmen. Ebenso ist die Spur des Thieres im Sande längs dem Flußufer Gegenstand seiner genauen Nachforschung, und wenn die Spur frisch ist, so stellt er die Falle auf dem Wege des Thieres auf, verbirgt sie unter dem Wasser und befestigt sie mit einer starken Kette entweder an einen Pfahl, der im Sande eingerammt ist, oder an einen starken Strauch oder Baum. Ein Floß von leichtem Holz wird an die Schnur mit einem mehrere Fuß langen Tau festgebunden, damit es, wenn der Biber die Schnur mit sich fortreißen sollte, auf dem Wasser oben auf schwimmend die Richtung anzeige, in welcher der Biber sich entfernt hat. Der Köder an der Schnur, welcher recht naiv „die Medicin“ heißt, ist eine ölartige Substanz, welche man von dem Biber selbst erhält (Bibergeil). Diese Medicin bekommt, wie so manche andere Medicin, auch dem armen Biber nicht gut. Der Jäger taucht in dieselbe einen Stock und legt diesen quer über die Schnur; wenn nun der Biber, gelockt durch den Geruch, das Ding näher untersuchen will und zu dem Ende einen seiner Füße in die Falle steckt, dann ist die Sache gemacht, und das Thier ist „a gone beaver“, ein in die Falle gegangener Biber. Entdeckt der Jäger ein Bibernest, so setzt er die Falle auf den Rand des Dammes, ungefähr dahin, wo er glaubt, daß der Biber vom tiefen zum seichten Wasser taucht. Früh am Morgen besteigt nun unser Jäger sein Reitpferd, um nach den Fallen zu sehen. Er zieht den gefangenen Thieren sogleich die Haut ab, packt die Schwänze, welche von besonderem Werth sind, sorgfältig ein und spannt die Felle aus, um sie zu trocknen; das Fleisch nebst den Eingeweiden wird mit großer Behutsamkeit abgeschabt und gereinigt. Sind die Felle trocken, so werden sie in viereckiger Form, mit dem Pelzwerk nach innen, zusammengelegt, in Packen, deren jeder gewöhnlich 10 bis 20 Stück enthält, gebunden und so fest als möglich zusammengepreßt, so daß er für die bequemere weitere Fortschaffung geeignet ist.
Während der ganzen Dauer der Jagdzeit wandert der furchtlose Jäger trotz der Nähe der Indianer rund herum zur Aufsuchung von „Zeichen“. Seine Nerven sind immer gespannt, seine Geistesgegenwart muß er immer rege erhalten. Nach allen Seiten fliegen seine Adleraugen und augenblicklich entdeckt er jeden auch noch so unbedeutenden auffälligen Gegenstand, der ihm auf seinen Wegen entgegentritt. Ein umgewendetes Blatt, ein niedergetretener Grashalm, die Unruhe der Thiere, der Flug der Vögel sind für ihn Begebenheiten, gezeichnet mit der sichern Hand der Natur in deutlichster Sprache.
Der Indianer wendet alle seine Kunstgriffe an, um den weißen Jäger irre zu führen und über ihn zu triumphiren; dieser aber verbindet trotz aller seiner Roheit mit dem natürlichen Instinkt des Pionierers den Vortheil von wenigstens einigen Wohlthaten der Civilisation und entgeht dadurch gewöhnlich den plump angelegten Plänen der Indianer. Nicht selten sind freilich seine Vorsichtsmaßregeln doch vergebens. Wenn der Indianer die Stelle ausfindig gemacht hat, wo der Biberjäger seine Fallen aufstellte, so schleicht er sich wie eine Schlange spurlos dahin und verbirgt sich in den Büschen, bis sein Opfer erscheint. Der Pfeil fliegt vom Bogen und bei so kurzer Entfernung verfehlt derselbe selten sein Ziel. Das Geschwirr des Pfeils ist von dem Jäger kaum vernommen, so fühlt er auch schon die Spitze in seinem Herzen und der jubelnde Wilde hat eine weiße Kopfhaut mehr zur Ausschmückung seines Wigwam (Hütte). Im Ganzen ist aber, wie gesagt, der Vortheil doch auf Seiten der Biberjäger, und wenn die Jagd zu Ende ist, so haben diese für jeden verlorenen Kameraden Dutzende von rothen Kopfhäuten auf ihren verschiedenen Sammelplätzen in den Lagern vor den Handelsforts aufzuweisen.
Die Schilderung eine solchen Lagers und die Geschichte des alten Schweden in einer nächsten Nummer.